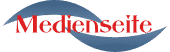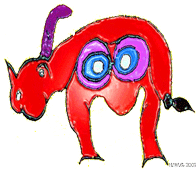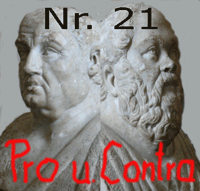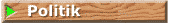









|

Auf dieser Seite veröffentlichen wir Rezensionen
Zu weiteren Rezensionen siehe rechts unten:
Die Ausgaben der Erinnyen
Inhalt
Die normativen Grundlagen der Kapitalkritik bei Marx
Eine Rezension des Buches von Frank Kuhne: Marx und Kant. Die normativen Grundlagen des Kapitals, Weilerswist 2022.
Rezensent: Bodo Gaßman
Zur Rezension...

Rezension von Arno Kaiser
Bodo Gaßmann: Manifest der Autonomie der kritischen Philosophie.
Die geistige Situation der Zeit und die Aufgaben des emanzipatorischen Denkens, Garbsen 2023.
(Paperback; 212 S.; 12,00 €)
Zur Rezension...
(Zu beziehen über: www.erinnyen.com
oder direkt: buecher@erinnyen.de)

Rezension von Bodo Gaßmann
Berechtigte Kritik wird mit falscher Theorie zur Ideologie
Über Precht/Welzer: Die vierte Gewalt
Zur Rezension...

Kritik der historischen-hermeneutischen Methode
Ottfried Höffe (Hrsg.): Die Nikomachische Ethik. Klassiker Auslegen. 4. neubearbeitete und ergänzte Auflage, Berlin/Boston 2019 (De Gryter).

BodoGaßmann über das Buch von
Christoph Türcke: Lehrerdämmerung. Was die neue Lernkultur in den Schulen anrichtet, München 2016 (C.H. Beck-Verlag)

Frank Kuhne:
Selbstbewußtsein und Erfahrung bei Kant und Fichte.
Über Möglichkeiten und Grenzen der Transzendentalphilosophie. Reihe: Paradeigmata 27. Hamburg 2007. (Meiner Verlag) Zur Rezension...

Jean-Claude Paye:
Das Ende des Rechtsstaats. Demokratie im Ausnahmezustand, Zürich 2005.
Zur Rezension...
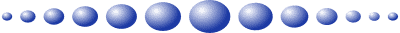
Frank Kuhne:
Selbstbewußtsein und Erfahrung bei Kant und Fichte.
Über Möglichkeiten und Grenzen der Transzendentalphilosophie. Reihe: Paradeigmata 27. Hamburg 2007. (Meiner Verlag)
Zur Druckfassung...
Über die Leistung einer Rezension
Ein solches wissenschaftliches Werk, wie es Frank Kuhne vorlegt, ist nicht für Laien oder Studenten in den ersten Semestern gedacht, sondern für den Kenner der Materie. Wenn man bedenkt, dass der bekannte Physiker Hawkings die „Kritik der reinen Vernunft“ von Kant, die zusammen mit Fichtes „Wissenschaftslehre“ von 1794/5 im Mittelpunkt der Untersuchung steht, nicht lesen konnte, weil sie ihm zu schwer erschien (vgl. Erinnyen Nr. 6, S. 76), dann wird deutlich: Man braucht einen langen Atem, das Buch als Beginner zu verstehen. Vorausgesetzt ist die Lektüre der Basistexte: die drei Kritiken von Kant und die Wissenschaftslehre von Fichte. Oder anders herum: Beim Studium dieser Werke ist Kuhnes vorliegende Arbeit eine ideale Lektürehilfe für diejenigen, die sich ernsthaft mit den beiden Philosophen auseinandersetzen wollen. Denn das Buch von Kuhne gibt den Forschungsstand wieder und treibt ihn avanciert weiter.
Wissenschaftstheorie kann man nicht rational betreiben und sich nicht ein wahres Selbstbewusstsein über das menschliche Denken aneignen, ohne die sogenannte „Klassische Philosophie“ zu studieren. Wer sich auf die Philosophie einlässt, ihre Geschichte nicht als beliebige Erzählung, die einzelnen Gestalten der Philosophie nicht als Paradigma betrachtet und auf das, was es sonst noch an Verfallserscheinungen des philosophischen Denkens gibt, hereinfallen will, sondern die Entwicklung der Philosophie als Entfaltung ihrer Wahrheit geistig erfahren will, der kommt nicht um das Studium von Kant, Fichte, Schelling und Hegel herum. Und will er nicht die Aporien und gültigen Lehrstücke dieser Epoche selbst neu entdecken, dann kommt er nicht um das Studium von Kuhnes Schrift herum.
Entsprechend der Vielfalt der Probleme, der Komplexität der Gedanken und der Abstraktheit der Thematik kann eine Rezension solch ein Buch, wie es Kuhne veröffentlicht hat, nicht referieren. Der Rezensent kann entweder den Inhalt nur verdoppeln, dann wäre eine direkte Lektüre mit den exakten Formulierungen von Kuhne geeigneter; oder er gibt die Thesen Kuhnes zusammenfassend wieder, dann würde gerade die Stärke des Werkes, seine Argumentation, verloren gehen, der Leser würde diese Thesen mit seinem vorgängigen Bewusstsein vergleichen und ihnen entweder zustimmen oder sie ablehnen. Beides wäre unphilosophisch, denn diese Wissenschaft ist nicht ohne ihre Begründung und ohne ihre Beweisführung eine Wissenschaft, sie wäre nur Meinung. Ich werde mich deshalb nach einem groben Abriss der Themen exemplarisch mit einigen Gedankengängen beschäftigen, um dem Leser anzuregen, das Werk von Kuhne intensiv zu lesen.
Das natürliche Bewusstsein – anstatt einer Einleitung
Die Weltauffassung auf dem „Standpunkt des Lebens“, des „gesunden Menschenverstandes“, des „natürlichen Bewusstseins“, des Alltagsbewusstseins, der „natürlichen Menschheit“ hat Friedrich Heinrich Jacobi in zwei Sätzen auf den Begriff gebracht: „Ich bin, und es sind Dinge außer mir“ (zitiert nach S. 220). Die „Gewissheit“ dieser zwei Sätze beruht nicht auf Beweisen, sondern auf dem Glauben. Da es kein Ich gibt ohne einen Gegenstand, dieser aber nicht bewiesen ist, sondern nur geglaubt werden kann, sind beide Sätze auch zweifelhaft. Will man sich überhaupt auf Philosophie und Wissenschaftstheorie einlassen, dann muss man sich auf das beweisende Denken einlassen. Das ptolemäische Weltbild, das man tausend Jahre geglaubt hat (nach dem man sogar die Sterne berechnen konnte), wurde durch Galilei widerlegt, durch das kopernikanische ersetzt und durch Kepler astronomisch und durch Newton physikalisch bewiesen. Dieses entwickelte kopernikanische „Weltbild“ ist aber kein natürliches Bewusstsein, sondern eine komplizierte Konstruktion, die offen den Sinneseindrücken widerspricht. Was hier Gegenstand des menschlichen Geistes ist, ist einem natürlichen Bewusstsein unzugänglich (auch wenn es vielen heute als natürlich erscheint, weil sie es von klein auf gelernt haben).
Was die Kantische und Fischtische Philosophie ihrem Selbstverständnis nach auszeichnet, ist die wissenschaftstheoretische Erklärung des Ichs und seines Gegenstandes. Dabei werden weder von Kant noch von Fichte die beiden Sätze Jacobis bestritten – entgegen dem Vorurteil, das Lenin über den Idealismus in die Welt gesetzt hat, sondern ihre Philosophie will beide rechtfertigen und begründen, damit aus dem Glauben an sie und ihre dogmatische Behauptung bei Jacobi wahres Wissen durch die spekulative Philosophie wird, sei diese nun transzendentaler Idealismus und empirischer Realismus zugleich wie bei Kant oder bloß transzendentaler Idealismus wie bei Fichte. So sagt Fichte: „Der Realismus, der sich uns allen, und selbst dem entschiedensten Idealisten aufdringt, wenn es zum Handeln kömmt, d.h. die Annahme, daß Gegenstände ganz unabhängig von uns außer uns existiren, liegt im Idealismus selbst, und wird in ihm erklärt, und abgeleitet.“ (Zitiert nach S. 219) Fichte kritisiert sowohl den dogmatischen Realismus wie den dogmatischen Idealismus. „Der dogmatische Realist führt die Einschränkung des Ich auf das Ding an sich als bewußseinstranszendente Ursache zurück, abstrahiert dabei aber davon, daß dieses Ding nur gedacht werden kann, mithin dem Bewußtsein immanent ist. Der dogmatische Idealist führt die Einschränkung des Ich auf das Ich selbst zurück, ohne damit begründen zu können, wie es möglich ist, daß das Ich etwas vorstellt, was es nicht selbst ist.“ (Zitiert nach S. 233)
Zurück zum Anfang
Überblick
In dem Kapitel: „I. Kant“, folgt Kuhne in seiner Erörterung im wesentlichen dem Aufbau der „Kritik der reinen Vernunft“, so beginnt er mit „A. Transzendentales und empirisches Ich“, in dem er u.a. die Themen „Affektion und Ding an sich“, „Subjekt der Erkenntnis und innere Erfahrung“ und „Subjekt und Objekt der Erkenntnis“ behandelt. Unter „B. Verstand, Vernunft, Urteilskraft“ werden u.a. die kosmologischen Ideen der Vernunft, das transzendentale Ideal und „Selbständigkeit und Unselbständigkeit der Moral“ untersucht.
Im Teil II. geht es um Fichte, die „Unmittelbarkeit des unmittelbaren Bewußtseins“, die Einheit von theoretischer und praktischer Vernunft, den „Anstoß“, um dann auch die Sittenlehre und das Naturrecht mit einzubeziehen. Im letzten Teil „III. Jenseits von Kant und Fichte“ zeigt Kuhne in einem nochmaligen Rekurs auf Kant wie eine „Aufhebung der Transzendentalphilosophie in Gesellschaftstheorie“ möglich ist und warum sie notwendig ist.
Die „Generalthese dieser Arbeit“ lautet: „Philosophie, die bei sich selbst bleibt, vermag nicht ‚ihre Zeit in Gedanken zu erfassen’. Sie kann weder ihre Gegenstände noch sich selbst adäquat begreifen. Dies ist an Kants kritischer Philosophie und Fichtes früher Wissenschaftslehre auf dem Wege der immanenten Kritik zu zeigen.“ (S. 7)
I. Kant
Allgemein zu Kant
Kant gilt in der Philosophiegeschichte allgemein als derjenige, der den Empirismus und Rationalismus in einer neuen Synthese vereinigt habe, quasi beide Positionen auf eine neue Stufe gehoben habe. Die Kategorien, mit denen wir die Anschauungen, Vorstellungen oder Erscheinungen konstituieren und ordnen aus der für uns unbestimmten Mannigfaltigkeit her zu Bewusstseinsgestalten herausheben, sodass sie erst für uns etwas bedeuten, diese Kategorien sind (etwas pauschalisiert) nach Ansicht des Rationalismus angeborene Ideen, nach Ansicht des Empirismus in uns vorgefundene, empirisch erfasste Vorstellungen („Ideen“). Da die These von den angeborenen Ideen nicht beweisbar, eine bloße Behauptung ist, die innere empirische Erfahrung der Kategorien aber zu keiner sicheren Verallgemeinerung taugen kann, münden beide philosophische Richtungen letztlich im Skeptizismus. Dagegen geht Kant einen anderen Weg bei seiner „Deduktion“ der Kategorien. Nach Kant haben wir schon wahre Wissenschaft in Gestalt der metaphysischen Naturwissenschaft von Newton und der Mathematik. Diese, so könnte man Kant ergänzen, sind notwendige Bedingungen der Möglichkeit der Industrialisierung und die Industrialisierung ist die notwendige Bedingung unserer heutigen Existenz – also müssen diese Wissenschaften wahr sein. Kuhne stimmt dieser „pragmatischen“ Begründung durch Kant generell zu (S. 334), kritisiert aber die Durchführung bei Kant.
Datensensualismus
Kuhne beginnt, Kants Aufbau der KrV folgend, mit der transzendentalen Ästhetik. Der Autor der Studie wirft Kant vor, den „Datensensualismus“ des ausgearbeiteten Empirismus von John Locke zu folgen. Nach diesem führen die Sinne dem Geist eine Reihe verschiedener Wahrnehmungen von Dingen zu, d.h., „sie führen von den Gegenständen der Außenwelt her dem Geist dasjenige zu (…), was in dem selben jene Wahrnehmung hervorruft“ (S. 19, Locke; Anm. 9). Diese Wahrnehmungen nennt Locke „sensationen“. Kant übernimmt bis in die Formulierungen hinein diese Auffassung, obwohl sie nach Kuhne nicht mit seiner Transzendentalphilosophie vereinbar ist. „Nach dieser Theorie sind keine ‚Gegenstände’ gegeben, sondern Empfindungsdaten, und die Gegenständlichkeit des Gegebenen ist Resultat der kategorialen Synthesis der produktiven Einbildungskraft. ‚Objekt (…) ist das, in dessen Begriff das Mannigfaltige einer gegebenen Anschauung vereinigt ist.’“ (Kant KrV B 137; S. 21) Indem Kant in der transzendentalen Ästhetik „das Erkennbare seinem Dasein nach als empirisch Gegebenes faßt, bindet er alle Erkenntnis an die Rezeptivität des empirischen Subjekts. Indem er nachweist, daß die Empfindungsdaten zwar notwendig in den apriorischen Formen der Anschauung Zeit und Raum gegeben sind, durch ihr Gegebensein in diesen Formen aber nicht als identische Gegenstände bestimmt sind, erhebt er die vom Sensualismus und Empirismus behauptete Strukturlosigkeit und Partikularität des Dinglichen (Locke) bzw. der sinnlichen Dingvorstellungen (Hume) in den Rang einer systematischen Bestimmung.“ (S. 73)
Bestimmungen wie „Reproduzibilität der Erscheinungen“, „Affinität des Mannigfaltigen“, und „Gegenstand (…) der Vorstellungen“, die auf die metaphysische Ansichbestimmtheit der Erscheinungen anzeigen, „erweist Kant jeweils als transzendentale Bestimmungen des erkennenden Subjekts (genitivus objectivus). Der objektive Grund der Reproduzibilität der Erscheinungen ist kein metaphysischer, sondern die transzendentale Einheit der Apperzeption respektive die kategoriale Synthesis der produktiven Einbildungskraft.“ (S. 74) Durch diese Argumentation Kants entsteht ein Zirkel: Wenn die Einheit, die einen Gegenstand notwendig macht, nichts anderes ist, als die transzendentale Einheit der Apperzeption in der Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellungen und die Vorstellungen des Mannigfaltigen durch die Kategorien konstituiert sind, dann „gründet die Erkenntnis allein in der transzendentalen Subjektivität“ (S. 77). Diese konstituiert die Gegenstände der Erkenntnis und die von ihr konstituierten Gegenstände erweisen den Erkenntnisapparat als inhaltsvoll und damit als Vermögen von Etwas und nicht von Nichts.
Zurück zum Anfang
Das Magnetismus-Beispiel
Dass nicht einfach Wahrnehmungsdaten, die von der rezeptiven Sinnlichkeit aufgenommen werden und vom spontanen, aber nicht produktiven Verstand synthetisiert werden, einen Gegenstand der Erkenntnis ergeben, macht Kuhne am Kantischen Beispiel des Magnetismus deutlich. Magnetismus als Gegenstand ist kein „Ding“, sondern nur aus wahrnehmbaren Wirkungen bestimmt. Diese Einsicht widerspricht aber Kants Restriktion des Kausalverhältnisses auf Gegenstände möglicher Wahrnehmung (wie etwa die brennende Kerze von Descartes, die einen Klumpen Wachs verursacht). „Dieser Gegenstand wäre nicht einfach vorzeigbar, sondern er wäre erschlossen als Existenz- und Bestimmungsgrund der wahrnehmbaren Wirkungen. Doch Kant zieht diese Konsequenz, die seine Bestimmung, Begriffe des Verstandes hätten im Unterschied zu solchen der Vernunft ein Korrelat in der sinnlichen Anschauung, nahelegt, nicht. Statt dessen verweist er auf ‚unsere Sinne’, ‚deren Grobheit die Form möglicher Erfahrung überhaupt nichts angeht’.“ (S. 47)
Die Schlussfolgerung aus dieser Kritik von Kuhne kann dann nur sein, dass der Verstand nicht nur das sinnliche Datenmaterial synthetisiert, sondern aktiv durch denken erschließt und konstruiert, also auch produktiv ist. Ein solcher ist aber mit der KrV, wie sie vorliegt, nicht vereinbar.
Das „Ding an sich“
Durch diese Einsicht ist auch die Konstruktion der Beziehungen von „Ding an sich“ als unbekannte Ursache der Erscheinungen zum konstruierten Gegenstand im Bewusstsein „dunkel“. Schon Jacobi hatte dieses Verhältnis kritisiert. „Kant beziehe die Kategorie Kausalität auf das Verhältnis von Ding an sich und Erscheinung, während ihr objektiver Gebrauch seiner Theorie zufolge doch auf Erscheinungen eingeschränkt sei.“ (S. 23) Kant hatte trotz dieser frühen Kritik an dem Noumenon (bloß gedachter Begriff) festgehalten, weil er nicht in die reine Bewusstseinsimmanenz fallen will (wie später Fichte oder der Neukantianismus von Rickert), weil sein transzendentaler Idealismus zugleich ein empirischer Realismus sein soll (S. 29, Anm.). Abschließend schreibt Kuhne zu der Äquivokation im Ausdruck „Ding an sich“, einmal unbekannte Ursache der Erscheinungen und andererseits der empirische Gegenstand selber bzw. sein mentales Korrelat zu sein: „Kant bestimmt das Ding an sich als intelligible Ursache der Erscheinungen, um durch die Unterscheidung von Ding an sich und Erscheinung die Erscheinungen als dem Dasein nach empirisch gegebene, der Gegenständlichkeit nach aber durch kategoriale Synthesis konstituierte Gegenstände bestimmen zu können. Dies hat Konsequenzen für die dabei beteiligten ‚Vermögen’ der Erkenntnis. Der Verstand, der im Verein mit der transzendentalen Einbildungskraft nicht die Gegenstände, sondern nur deren Gegenständlichkeit hervorbringt, das heißt die allgemeine Form der Gesetzmäßigkeit der Totalität der Erscheinungen konstituiert, ist darauf angewiesen, daß ihm etwas in der Sinnlichkeit gegeben ist. Die Sinnlichkeit kann aufgrund der Subjektivität ihrer apriorischen Formen Raum und Zeit nur Erscheinungen, nicht Dinge an sich enthalten.“ (S. 32) Der Begriff des „Dinges an sich“ soll bloß ein „Grenzbegriff “ und nur von negativem Gebrauche sein. Die scheinbare Präzisierung führt aber wieder zu anderen Ungereimtheiten. Im Begriff der Erscheinung ist notwendig der Begriff eines Dinges an sich als ontologisches Korrelat mitgedacht, zugleich soll es ein Noumenon sein, also ein Begriff des Verstandes, also kein ontologischer Begriff. Ist das Ding an sich die intelligible Ursache der Erscheinungen, kann es nicht die Affekte der empirischen Subjekte bewirken, ist es die ontologische unbekannte Ursache der Erscheinungen, dann kann es nicht die intelligible sein. In der Kantischen Transzendentalphilosophie werden die Widersprüche nicht gelöst. (Vgl. auch unsere Rezension von Haag: Fortschritt der Philosophie, in: Erinnyen Nr. 1 S.65.)
Zurück zum Anfang
Das empirische und das transzendentale Bewusstsein
Kant hat aber den Anspruch, das Besondere an den Gegenständen zu erkennen, das „nicht vollständig abgeleitet werden“ kann aus den Kategorien bzw. der transzendentalen Einheit der Apperzeption (vgl. Kant: KrV B 165). Der Verweis Kants auf die empirische Erfahrung ist für Kuhne nicht ausreichend: „Richtig ist, daß die transzendentale Einheit der Apperzeption nicht von der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe über den Schematismus der reinen Verstandesbegriffe und die Grundsätze des reinen Verstandes hin zu besonderen Naturgesetzen spezifiziert werden kann“. Denn aus diesen allgemeinen Prinzipien lässt sich kein spezielles Prinzipatum ableiten. Dies hat Fichte versucht, indem er aus dem Ich das Nicht-Ich setzen wollte. „(…) richtig ist ferner, daß die Kenntnis besonderer Naturgesetze ohne Erfahrung nicht denkbar ist.“ (S. 78) Beschränkte man die Erkenntnis auf empirische Erfahrung, ohne apriorische Konstruktionsprinzipien, dann ließe sich keine „wahre allgemeine Gültigkeit (begründen), weil sie nicht apriori, sondern nur auf Induktion gegründet wären“ (Kant: KrV, B 240 f.). Dies ist Kants Kritik am Empirismus (und ich ergänze: an allen Spielarten des heutigen Positivismus). „Hingegen ist unklar, was Kant hier unter Erfahrung und dem „Kennenlernen“ von Naturgesetzen versteht.“ (S. 78) Obwohl Kant ständig von Erfahrung und Anschauung als Voraussetzung von inhaltlich besonderen Erkenntnissen spricht, ist nach Kuhne auf der Basis der „Kritik der reinen Vernunft“ gar keine wirkliche Erfahrung möglich.
„Die Sinnlichkeit, insofern sie als Empfänglichkeit des Subjekts für empirisch gegebene Empfindungsdaten bestimmt ist, kann nicht dem transzendentalen, sondern nur dem empirischen Subjekt zugeschrieben werden. Die Unabhängigkeit der Sinnlichkeit von den Sinnen des empirischen Subjekts machte sie zu einer formalen Bestimmung des transzendentalen Ich überhaupt, welches damit ein absolutes Ich wäre, dem nichts empirisch gegeben wird, sondern das durch seine eigene Tätigkeit den Stoff hervorbringt.“ (S. 59) Die Sinnlichkeit als transzendentaler Begriff bei Kant lässt empirische Erfahrung gar nicht zu, das transzendentale Ich kann keine Erfahrungen machen. Ein empirisches Ich aber kommt nicht systematisch in der KrV vor; als bloß empirisches wäre es ein „vielfarbiges Subjekt“ (Kant), ein „Bündel (…) mit verschiedener Perzeptionen, die einander mit unbegreiflicher Schnelligkeit folgen und beständig in Fluß und Bewegung sind“ (Leibniz)(S. 59). Kuhne korrigiert deshalb Kant, um den Geist der kantischen Intention gegen den Wortlaut und die Konstruktion der KrV zu rechtfertigen. „Wenn demnach die transzendentale Einheit der Apperzeption nicht unmittelbar die Einheit des empirischen Bewußtseins sein kann, muß es eine von ihr unterschiedene Einheit des empirischen Bewußtseins geben, denn ohne diese gehörte das empirische Bewußtsein, das heißt die Mannigfaltigkeit der empirisch gegebenen Vorstellungen, keinem identischen Subjekt an. Es gäbe gar kein Subjekt, das in seinem Bewußtsein Vorstellungen ‚antreffen’ könnte.“ (S.59) Nach Kuhne hätte Kant deshalb unterscheiden müssen zwischen der „empirischen Einheit des Bewußtseins“, die zufällig wäre und den Gesetzen der Assoziation folgte, der „Einheit des empirischen Bewußtseins“, die unabhängig von der transzendentalen zu denken wäre und die auch die Widersprüche im Material der Erkenntnis denken könnte, um sie zu überwinden, und der „transzendentalen Einheit der Apperzeption“, welche die Form wissenschaftlich gültiger Resultate wäre und keinen Widerspruch zulassen könnte, ohne sich zu zerstören.
Nach der Konstruktion der KrV jedoch wird das empirische Subjekt zum bloßen Funktionsorgan des transzendentalen Subjekts, seine Leistung auf die Funktion der Erkenntnis reduziert. Das Bewusstsein von transzendentalem und empirischem Selbstbewusstsein ist bei Kant nicht aufgeklärt. „Das Bewußtsein dieses Verhältnisses kann nämlich weder in das transzendentale Bewußtsein fallen, da dieses sich selbst nicht thematisch ist, noch in das empirische Bewußtsein, das sich als solches nicht transparent ist auf die Bedingungen seiner Möglichkeit, es sei denn, sein Träger entschließt sich, Erkenntnistheorie zu treiben. Das Bewußtsein des Verhältnisses von transzendentaler Einheit der Apperzeption und empirischem Selbstbewußtsein fällt in eine dritte Instanz, in die transzendentale Reflexion, die auf die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis geht.“ (S. 67)
Zurück zum Anfang
Verstand und Vernunft
Distributive Einheit des Erfahrungsgebrauchs und kollektive Einheit des Erfahrungsganzen
Nach Kant ist der Verstand das Vermögen zu urteilen und ein gegebenes sinnliches Mannigfaltiges zur Einheit zu synthetisieren, die Vernunft ist das Vermögen zu schließen und die einzelnen Erkenntnisurteile des Verstandes unter Ideen (nicht-empirische Begriffe) zu synthetisieren, sodass schließlich eine stimmige Theorie („absolute Ganzheit“) entsteht. Das Beispiel „Magnetismus“ hat aber bereits gezeigt, dass diese klare Trennung in der wissenschaftlichen Erkenntnis nicht durchzuhalten ist. Der Verstand lässt sich nicht auf „mögliche Erfahrung“ restringieren, ebenso sind die (Vernunft)Ideen nicht nur regulativ für den Verstand.
„Die transzendentalphilosophische Unterscheidung zwischen der kollektiven Einheit des Erfahrungsganzen und der distributiven Einheit des Erfahrungsgebrauchs des Verstandes ist nur dann begründet, wenn die Trennung von Idee und Dasein im Vernunftbegriff der kollektiven Einheit des Erfahrungsganzen aufgehoben ist. Zwar ist die Welt als ganze, mit Kant, kein Gegenstand möglicher Erkenntnis, aber die objektive Realität des Weltganzen ist selbst eine notwendige Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis. Transzendentalphilosophisch muß die objektive, wenngleich nicht die durchgängige Identität des Weltganzen notwendig gedacht werden, denn ohne diese bliebe die Unterscheidbarkeit von Gegenstandsbereichen der Wissenschaften mysteriös.“ (S. 113) Insofern die Vernunft und ihre Ideen den Verstandesgebrauch erst ermöglicht, ist sie entgegen Kant konstitutiv, insofern sie die Richtung des Erkenntnisfortschritts antizipiert, ist sie regulativ (vgl. 117). Diese Einsicht hat ontologische Konsequenzen. „Bedingung der Möglichkeit der Abgrenzung von Gegenstandsbereichen ist eine ontologische Ordnung des Weltganzen, die zwar nicht positiv bestimmt werden kann, wohl aber als Bedingung der Möglichkeit der Identifizierung partikularer Gegenstandsbereiche notwendig zu denken ist. Der Beweis ist apagogisch: Träfe auf die Idee der kollektiven Einheit des Erfahrungsganzen zu, was nach Kant für alle Weltideen gilt, und ihr Gegenstand wäre ‚bloß in eurem Gehirne, und kann außer demselben gar nicht gegeben werden (…)’, bliebe unerklärbar, wie die distributive Einheit des Erfahrungsgebrauchs des Verstandes, also die wissenschaftliche Bearbeitung eines partikularen Problems, überhaupt möglich sein soll (…)“. (S. 113)
Zurück zum Anfang
Das Moralgesetz als „Fakt der Vernunft“
Nachdem Kuhne die Inkonsequenzen und Aporien der 3. Antinomie der KrV herausgearbeitet hat, die vor allem in der ungeklärten Vermischung von ontologisch-metaphysischen und transzendentalen Bestimmungen besteht, muss die Freiheit des Menschen, die in der KrV nach Kant nur als Möglichkeit bewiesen wurde, positiv in der „Kritik der praktischen Vernunft“ bewiesen werden. Aufgabe dieser zweiten Kritik sei es, die Realität der Freiheit durch ein apodiktisches Gesetz der praktischen Vernunft zu beweisen. „Die Realität der Freiheit wurde erkannt durch das Bewußtsein des moralischen Gesetzes, welches ein unmittelbares Bewußtsein oder ein ‚Faktum der Vernunft’ sei.“ (S. 145) Kuhne kritisiert diese Argumentation, nicht nur weil dieser Terminus eine Deduktion des Moralgesetzes aus der Selbstgewissheit des Denkens für gescheitert erklärt, sondern auch, weil es widersprüchlich ist.
„Der Ausdruck ‚Faktum der Vernunft’ ist äquivok. Er bezeichnet zum einen die Art, wie das Bewußtsein des moralischen Gesetzes für ein empirisches Subjekt ist: Es findet dieses Bewußtsein faktisch in sich vor, sobald es Maximen entwirft. Er bezeichnet zum anderen, daß man dieses Bewußtsein ‚nicht aus vorhergehenden Datis der Vernunft, z. B. dem Bewußtsein der Freiheit (…), herausvernünfteln’ oder ableiten kann. In der ersten Bedeutung beschreibt er eine Erfahrung, von der Kant behauptet, daß sie jedermann geläufig ist. Die drastischen Beispiele sollen diese Erfahrung illustrieren. In der zweiten Bedeutung beschriebt er keine Erfahrung, sondern ist gewissermaßen eine transzendentalphilosophische Reflexionsbestimmung des moralischen Bewußtseins, die besagt, daß die Geltung des moralischen Gesetzes nicht bewiesen, das Gesetz nicht deduziert werden kann.“ (S. 145)
Kant versucht die Einwürfe gegen seine Bestimmung der Moralphilosophie dadurch zu beheben, indem er zwischen Moralgesetz als Erkenntnisgrund der Freiheit und der Freiheit als Seinsgrund des moralischen Gesetzes unterscheidet. Durch das Moralgesetz seien wir uns unserer Freiheit (Autonomie) bewusst. Die theoretische Möglichkeit der Freiheit sei aber vorausgesetzt, damit das Moralgesetz überhaupt praktisch werden kann.
Kuhne beurteilt diesen Aspekt der praktischen Vernunft bei Kant folgendermaßen: „Kant beansprucht nicht, eine neue Ethik zu ‚erfinden’, vielmehr will er die im moralischen Bewußtsein gelegene unbedingte Forderung begrifflich aufklären. Dies gelingt ihm insofern, als er unter Ausschluß aller materialen Prinzipien das ‚Grundgesetz der reinen praktischen Vernunft’ als Prinzip der vernünftigen Bestimmung des Willens aufweisen kann. Problematisch ist aber, daß er das Bewußtsein dieses Grundgesetzes als ‚ein Faktum der Vernunft’ charakterisiert, welches ‚sich uns aufdrängt’. Diese Charakterisierung scheint eine Verlegenheit anzuzeigen, ähnlich der, die in der Bestimmung des reinen Selbstbewußtseins‚ Ich denke’ als ‚unbestimmte Wahrnehmung’ sich ausdrückt. Ein Faktum ist etwas, das empirisch vorhanden ist und als Vorhandenes vorgefunden wird. Die reine praktische Vernunft ist das Vermögen, ‚ohne Beimischung irgend eines empirischen Bestimmungsgrundes, für sich allein (…)’ den Willen zu bestimmen. Der Ausdruck Faktum der Vernunft scheint daher ein hölzernes Eisen zu sein. ‚(D)en Inhalt der Erkenntnis, die wir von einer reinen praktischen Vernunft, und durch dieselbe, haben (…)’, als ein Faktum zu bezeichnen, scheint unvereinbar mit dem Begriff der reinen praktischen Vernunft.
Ist das Bewußtsein des moralischen Gesetzes gegeben, so provoziert dies die Frage: durch wen oder was?“ (S. 186)
Zurück zum Anfang
Allgemeine Kritik der Kantischen Transzendentalphilosophie
Das Problem der Kantischen Transzendentalphilosophie ist es, dass sie nicht die besondere Erkenntnis erklären kann. Der Dualismus von apriorischer kategorialer Form und empirischen Inhalt muss Kant vermitteln, um gegen den Empirismus die Objektivität des Erfahrungsurteils begründen zu können. Diese Vermittlung muss aber zwangsläufig auf der Basis seiner Transzendentalphilosophie scheitern. „Die kategoriale Form, das unbedingt Allgemeine, und das empirisch Gegebene, das Kontingente, erweisen sich auf jeder Stufe ihrer Vermittlung innerhalb des in der Kritik der reinen Vernunft entwickelten transzendentalen Konstitutionssystems (Kategorien, Schemata, Grundsätze) als inkompatibel. Die bleibende Diskrepanz von Form und Inhalt nötigt Kant, die wirkliche Erfahrung des empirischen Subjekts zur transzendentalen Bestimmung zu erklären.“ (S. 166) Macht Kant die transzendentale apriorische Form stark, dann wird die wirkliche Erfahrung des empirischen Subjekts bloß zu einer transzendentalen Bestimmung erklärt. „In dem Maß, in dem Kant das empirische Gegebensein des Materials der Synthesis und seine Unabhängigkeit von der Einheit der Handlung der Synthesis stark macht, reduziert er das Selbstbewußtsein auf das diesem Material entgegenstehende, für sich leere ‚Ich denke’.“ (S. 166)
Auch dies widerspricht der Intention der KrV, die die notwendige Bedingung der Möglichkeit von Erkenntnis aufzeigen will. „Die Crux des Kantischen Dualismus ist die jeder strikt dualistischen Theorie. Sie muß die beiden Seiten, Form und Inhalt, als je für sich bestimmbar unterstellen. Da die Bestimmung des Inhalts der Erkenntnis aber notwendig der logischen Form genügen muß und eine Erkenntnis darstellt, gerät die dualistische Theorie entweder in einen Widerspruch zu sich selbst oder sie siedelt die Erkenntnis von Form und Inhalt jeder Erkenntnis in einer Metatheorie an, was sofort die Frage aufwirft, worin diese Metatheorie gründet. Entweder fällt ihr Begründung in eine dritte Theorie, deren Begründung in eine vierte usf. oder aber die Begründung der transzendentalen Erkenntnis ist reflexiv. Kant hat die Erkenntnis der Form und des Inhalts jeder Erkenntnis als transzendentale Erkenntnis von der Erkenntnis selbst geschieden. Den drohenden unendlichen Regreß ihrer Begründung in je anderen Metatheorien wehrt er ab, indem er dogmatisch auf dem ‚kritischen’ Sinn der transzendentalen Bestimmungen besteht, wonach diese Bedeutung allein in der Funktion der Begründung von Erfahrungserkenntnis haben und darüber hinaus nicht begründbar sind. Die Möglichkeit transzendentaler Erkenntnis bleibt so unerörtert.“ (S. 167 f.) Hätte Kant die Möglichkeit der transzendentalen Erkenntnis begründen wollen, dann hätte sie die Gestalt einer reflexiven Begründung haben müssen. Fichte hat diese Variante der Transzendentalphilosophie versucht.
Zurück zum Anfang
II. Fichte
Allgemein zu Fichte
Ist bei Kant das transzendentale Ich nicht reflexiv, so dass es starr und dichothomisch dem empirischen Material gegenüber steht, so geht Fichte über Kant hinaus. Seine Originalität besteht in der Unterscheidung von untersuchendem und untersuchten Ich. Das Ich wird reflexiv. „Das absolute Ich ist einmal das sich selbt setzende Ich oder die Tathandlung des Sich-Setzens. In dieser Bedeutung ist das absolute Ich als unteilbar dem teilbaren Ich entgegengesetzt. Das absolute Ich ist sodann Bewußtsein und als solches die Sphäre, die das teilbare Ich und Nicht-Ich umfaßt.“ (S. 202) Als unteilbares absolutes Ich folgt aus ihm nichts, denn aus dem Prinzip folgt nicht das Prinzipatum. Als teilbares Ich, das die absolute Einheit des Subjekts und Objekts sein soll, ist es nur behauptet, aber nicht systematisch entwickelt. (Das wird das Programm Hegels.)
Kuhne kritisiert diese Doppeldeutigkeit mit Hegel als „prinzipielles Ungenügen der Transzendentalphilosophie“ selbst. Die Tathandlung, die unmittelbare Subjekt-Objekt-Einheit sein soll (das „Ich setzt das Nicht-Ich“), soll mit der Reflexion als endliches Vorstellen vermittelt werden, ist es aber nicht. „Die Problematik der Vermittlung von Tathandlung und Reflexion bleibt in der Grundlage ungelöst.“ (S. 205) Fichte greift für diese Vermittlung auf den Begriff der intellektuellen Anschauung zurück, den Kant als nicht kommunizierbar verworfen hatte.
Ein Ich (Subjekt) kann nur gedacht werden, wenn es einen Gegenstand (Objekt) denkt wie ‚Tisch’ oder ‚Wand’ usf. Die Reflexion auf das Ich zeigt nun, dass im Denken des Ich Denken und Gedachtes ein und dasselbe sind. Fichte schließt daraus, das Denken und Gedachtes allgemein eine Einheit sind, der Unterschied von Denken und Gedachten im Denken aufgehoben ist. „Diese für das Denken von etwas konstitutive Differenz von Subjekt und Objekt ist auch in dem besonderen Fall des Denkens meiner selbst nicht aufgehoben – sie soll aber respektive sie muß aufgehoben sein, weil die Erklärung des Selbstbewußtseins sonst entweder in den unendlichen Regreß oder in den Zirkel geriete. Entweder das Subjekt der Selbstbeziehung wäre als Subjekt dieser Selbstbeziehung nur mittels eines ‚höheren Denkens’, einer zweiten Reflexion zu fassen, für deren Subjekt wiederum gälte, daß es als Subjekt dieser zweiten Reflexion nicht unmittelbar, sondern nur mittels einer dritten Reflexion zu fassen wäre und so fort, oder das Subjekt der Selbstbeziehung wäre als seiner selbst bewußtes je schon vorauszusetzen. In beiden Fällen wäre die These Fichtes, das Ich entstehe durch das Zurückgehen des Denkens auf sich selbst, von der ‚Sophisterei’ der Vorgänger nicht unterschieden.“ (S. 208)
Zurück zum Anfang
Unmittelbarkeit
Man kann sich bei Kuhnes Kritik an den Widersprüchen und Irritationen, die in der Fichteschen Wissenschaftslehre enthalten sind (ebenso bei Kant), fragen, warum man eine solche als Ganzes widerlegte Philosophie überhaupt studieren soll. Aber abgesehen von den neuen Erkenntnissen, die diese enthält, sind auch die falschen Aussagen Fichtes Teil der Wahrheit. Das zeigt Kuhne an Fichtes Behauptung der Unmittelbarkeit des Ich-Bewußtseins. Von Hegel stammt die Einsicht, dass alles zugleich vermittelt und unmittelbar ist. Dass dies nicht bloß eine widersprüchliche Behauptung ist, die man evtl. durch sprachliche Differenzierung lösen könne, sondern tatsächlich eine Einsicht, wird erst klar und wird erst bewiesen, wenn man Fichtes Versuch, die Unmittelbarkeit des Ich anzunehmen, widerlegt.
Fichte fordert den Leser seiner „Wissenschaftslehre“ bzw. seiner „Sittenlehre“ auf einzusehen, dass alles Bewußtsein bedingt ist durch das unmittelbar Bewußtsein unserer selbst. Doch dieses unmittelbare Bewusstsein ist selbst bedingt, wie Fichte eingestehen muss. „Fichte weist (…) darauf hin, daß der Aufweis des unmittelbaren Bewußtseins der Spontaneität des Ich, seiner Tätigkeit oder Agilität, bedingt ist durch das ‚Abändern’ der Bestimmtheit des Denkens, das ‚Uebergehen’ vom Denken der Wand zum Denken des Ich.“ (S. 227) Kuhne schreibt dazu: „Der Aufweis des unmittelbaren Bewußtseins der Selbsttätigkeit des Ich ist bedingt durch die abstrahierende Reflexion, welche zunächst auf die Wand als einen beliebigen äußeren Gegenstand geht, dann unter Abstraktion von diesem auf das Ich selbst. Die Reflexion unterliegt aber dem Gesetz der Bestimmung durch Gegensatz, mithin ist der Aufweis des unmittelbaren Bewußtseins der Spontaneität meines Denkens in allem Denken von etwas abhängig vom Reflexionsgesetz. Gerade diese Abhängigkeit von der Reflexion macht aber den Aufweis des präreflexiven, unmittelbaren Bewußtseins fragwürdig (…).“ (S. 227)
Dass dieses Ich-Bewusstsein zugleich auch unmittelbar ist, ergibt sich meines Erachtens daraus, dass es nicht einfach aus dem Denken konkreter Gegenstände (wie einer Wand) erschlossen werden kann, sondern vom reflektierenden Bewusstsein vorausgesetzt werden muss als Spontaneität des Denkens, als ursprüngliche Voraussetzung reflektierter Wissenschaft. Das „sich selbst setzende Ich“ ist dadurch vermittelt und unmittelbar zugleich. Freilich ist diese Einsicht, die man bei Fichte gewinnen kann, komplexer, da z. B. das Reflexionsgesetz bei Fichte Varianten aufweist, die bei ihm nicht explizit werden (vgl. Kuhne, S. 229).
Aus dem absoluten Ich folgt nichts. Wenn Fichte dennoch das absolute Ich als „Indifferenz von Einheit und Unterschiedenheit“ (S. 261) fasst, dann erschleicht er den Unterschied im absoluten Ich. „Indem Fichte dem Ausdruck „in sich zurückgehende Tätigkeit“ mal die Bedeutung reiner Selbstproduktion, mal die der Selbstreflexion zuschreibt und den zentralen Terminus ‚Setzen’ sowohl in der Bedeutung von Produzieren, Erzeugen, wie der von Vorstellen, Reflektieren verwendet, erschleicht er den Übergang von der Reflexion des Wissenschaftslehrers auf die Ichheit und die Subjekt-Objekt-Relation zur absoluten, der Ichheit immanenten Selbstreflexion. Die Ichheit ist als Tathandlung reine Selbstproduktion. Sie muß ursprünglich aber auch absolute Selbstreflexion sein.“ (S. 264) Die Vermittlung von Tathandlung und Reflexion ist in der Fichteschen Philosophie nur behauptet, nicht begründet.
Zurück zum Anfang
Der Anstoß – Bezug zum Ontologischen
Die Tathandlung des Ich, die das Nicht-Ich setzen soll, wäre ohne Richtung, wenn sie nicht auf Widerstand eines Etwas im Bewusstsein stieße. Damit das Ich nicht nur in Wechselwirkung mit sich selbst ist, bedarf es eines Anstoßes von außen. Der Anstoß von einem äußeren Etwas, von dem man nichts weiter sagen kann, „als daß es dem Ich völlig entgegengesetzt seyn muß“ (Fichte, zitiert nach S. 265), ist die Bedingung der Möglichkeit der gerichteten Wechselwirkung des Ich mit sich selbst. Das Ich wäre als in sich differenziertes nicht ohne sein anderes, das Nicht-Ich. Das Nicht-Ich ist aber durch das Ich „gesetzt“. Wenn es ein anderes als das Ich sein soll, so muss die Tathandlung des Ichs eine Richtung haben, diese hat das Ich aber nur, soll es sich nicht lediglich auf sich selbst beziehen, also ohne Richtung sein, wenn es einen „Anstoß“ durch das erfährt, was es nicht ist, durch ein außermentales Objekt. Erst durch den fremdartigen Anstoß kann die Tathandlung eine Richtung haben, die von der des reinen Ichs verschieden ist, erst dieser Anstoß erlaubt es von verschiedenen Richtungen zu sprechen (S. 260).
Im Begriff des „Anstoßes“ liegt aber nach Kuhne ein Widerspruch ähnlich dem, wie er beim „Ding an sich“ von Kant festgestellt wurde, nämlich dass der Anstoß als einer vom Ich zugleich abhängiger und durch ein unabhängiges Etwas verursachter vorgestellt wird. Auch Fichte sieht diesen Widerspruch, aber er erklärt ihn zu einer notwendigen Zirkularität des endlichen Geistes. Kuhne erläutert dies so: „Die philosophische Reflexion kann den Anstoß nicht als ontologisch-metaphysisches Prinzip fassen, denn als transzendentale Reflexion vermag sie die Immanenz des Bewußtseins nur um den Preis des Rückfalls in einen dogmatischen Transzendentismus, also gar nicht, zu überschreiten; sie kann den Anstoß nur in seiner Widersprüchlichkeit als denknotwendig einsehen, als ‚etwas widersprechendes, das aber dennoch als Gegenstand einer nothwendigen Idee allem unsern Philosophiren zum Grund gelegt werden muß, und von jeher (…) allem Philosophiren, und allen Handlungen des endlichen Geistes zu Grunde gelegen hat’“. (S. 266)
Dem Einwand, die Widersprüchlichkeit im „Anstoß“, einmal notwendiges Noumenon und zugleich „Ding an sich“ zu sein, kann Fichte entgegnen, dass die doppelte Natur des Anstoßes in der doppelten Natur Ichs begründet sei, einmal theoretische Vernunft und zugleich praktische Vernunft zu sein. Der Kommentar von Kuhne dazu: „In der Formulierung des notwendigen Zirkularität des sich selbst erklärenden endlichen Geistes spricht sich die Wissenschaftslehre als kritischer Idealismus aus, der auch als ein ‚Ideal-Realismus’ oder ‚Real-Idealismus’ bezeichnet werden kann. Realistisch ist sie insofern, als sie das Bewußtsein aus einem unabhängig von allem Bewußtsein Vorhandenen erklärt, idealistisch ist sie insofern, als ihr bewußt ist, daß sie in dieser ihr einzig möglichen Erklärung allein ihren eigenen Gesetzen unterliegt.“ (S. 267)
Dieser „Real-Idealismus“ oder „kritische Idealismus“ kann nicht befriedigen. Man kann aus dem Denken heraus die Notwendigkeit metaphysisch-ontologischer Voraussetzungen begründen, ohne aus diesen Voraussetzungen direkt Einzelerkenntnisse ableiten zu wollen.
„Die transzendentalphilosophische Reflexion setzt mit den Wissenschaften deren Inhalte, mit diesen die unterschiedenen Gegenstandsbereiche und damit die ontologische Bestimmtheit dieser Gegenstandsbereiche voraus. Diese ist unabhängig von dem Inhalt der existierenden Wissenschaften nicht positiv zu bestimmen. Als positive Bestimmung wäre sie nur in einer affirmativen Metaphysik möglich, die die Totalität des Seienden nach dem Modell der arbor porphyriana bestimmte. Ontologische Bestimmtheit ist aber ein erkenntnistheoretischer Reflexionsbegriff, der bezeichnet, daß die Ansichbestimmtheit der Gegenstandsbereiche (bzw. der Gegenstände) Bedingung ihrer Bestimmbarkeit, damit ihrer eindeutigen Unterscheidbarkeit ist. Wären sie nicht eindeutig unterschieden, könnten die Gegenstandsbereiche der verschiedenen Wissenschaften verwechselt werden. Wären sie gar nicht zu unterscheiden, gäbe es nur einen Gegenstandsbereich und es bliebe rätselhaft, weshalb es nicht nur eine sondern verschiedene Wissenschaften gibt. Daß es aber eindeutig unterschiedene Wissenschaften gibt, zeigt sich schon daran, daß nicht jede mathematische Form zugleich auch eine physikalische ist.“ (S. 335 f.)
Zurück zum Anfang
Das Apriorische und das Aposteriorische
Die Leistung der Fichteschen Wissenschaftslehre war es, den Dualismus Kants von apriorischer Kategorialität und sinnlich empirischen Daten, die aposteriori sind, aufgehoben zu haben. Entsprechend sind Apriori und Aposteriori dasselbe, nur unterschieden durch die Ansicht des Betrachters, ob er vom Nicht-Ich ausgeht (aposteriori) oder vom Ich (apriori). Da aber das Ich das Nicht-Ich als sein Anderes setzt (sich vorstellt, für sich konstruiert), auch in seiner Unabhängigkeit vom Ich, ist auch das Aposteriorische apriori. Der Stoff, der selbst Form ist (einen Stein kann ich mir nicht in den Kopf pressen, einzelwissenschaftliche Resultate haben eine allgemeine Form), ist nicht empirisch gegeben, sondern besteht nach Fichte im wirklichen Bewusstsein des menschlichen Geistes. Dadurch sind aber die Erkenntnisse nur in ihrer allgemeinen Form vorhanden. „Fichte beansprucht ebensowenig wie Kant die Ableitung besonderer Naturgesetze oder spezifischer Bestimmtheiten spezifischer Gegenstände aus der transzendentalen Einheit der Apperzeption oder notwendigen Handlungsweisen des Ich.“ (S. 296 f.) Fichte muss deshalb noch ein „absolut Zufällige(s)“, „bloß Empirische(s)“ zugestehen (S. 296), um bestimmte Erkenntnisse denken zu können, die nicht aus dem Ich deduzierbar sind. „Die Sphäre des bloß Empirischen ist für die Transzendentalphilosophie notwendig, denn sie markiert ihre Grenze. Umfaßt die Transzendentalphilosophie das a priori Notwendige in unserer Erkenntnis, so ist sie damit auch negativ bestimmt, gegen das a priori nicht-notwendige und insofern Zufällige in unserer Erkenntnis. Fichte hat diese Grenze nicht überschritten, sondern im Vergleich zu Kant gewissermaßen nur weiter hinausgeschoben. Wo sie genau verläuft, ist allerdings nicht deutlich.“ (S. 297)
Das Besondere sowohl bei Kant wie bei Fichte ist Gegenstand der reflektierenden Urteilskraft. Fichte unterstellt dabei ein empirisches Subjekt der Erkenntnis, dessen Denken kategorial nicht vollständig determiniert ist und das seine Begriffe zunächst nur versuchsweise an die Phänomene heranträgt. Ebenso unterstellt die reflektierende Urteilskraft, dass die Phänomene nicht vollständig bestimmt sind. Daraus folgt erstens, dass die Resultate der reflektierenden Urteilskraft nur problematisch sind, bestenfalls zu komparativer Allgemeinheit führen können. Und es folgt zweitens daraus, dass die Phänomene an sich bestimmt sein müssen. „Die Bestimmtheit der Gegenstände, die den Begriffen der Urteilskraft korrespondiert, ist eine Bedingung der Möglichkeit der Erkenntnis, die nicht im erkennenden Subjekt selbst liegt, sondern ihm transzendent ist. Sie bildet die ontologisch-metaphysische Voraussetzung für erfolgreiche Schlüsse der reflektierenden Urteilskraft.“ (S. 299) Beide Konsequenzen widersprechen aber der Transzendentalphilosophie, die objektive Geltung ihrer Resultate beansprucht und besonders bei Fichte jede ontologisch-metaphysische Voraussetzung (bis auf den „Anstoß“) ablehnt.
Zurück zum Anfang
III. Jenseits von Kant und Fichte
Die Aufhebung der Transzendentalphilosophie in Gesellschaftstheorie
Der Kantische Dualismus ist nicht haltbar. Auch Fichtes Bewusstseinsimmanenz der Transzendentalphilosophie scheitert an ihren Widersprüchen und Irritationen. Beide scheitern daran, dass die besondere Erkenntnis nicht mit dieser Philosophie bestimmt werden kann.
Wo sie dies versucht mittels der reflektierenden Urteilskraft wird sie gegen ihre Intention genötigt, metaphysische Voraussetzungen zu machen (S. 312). Schelling und Hegel haben eigentlich nicht aus einer immanenten Kritik heraus ihre Systeme geschaffen, sondern als Gegenentwurf zur Transzendentalphilosophie, indem sie von vornherein ihre Philosophie als ontologische konzipieren. Am Beispiel des Übergangs der Kategorie Unterschied in die Verschiedenheit aus der Hegelschen Seinslogik zeigt Kuhne, dass auch im absoluten Idealismus Hegels das Problem der besonderen Erkenntnis nicht gelöst ist. Denn die Hegelsche Ableitung der Verschiedenheit aus der der Kategorie Unterschied ist eine Subreption (S. 314).
Kuhnes Vorschlag zum Kantischen Dualismus, ein empirisches Subjekt einzuführen, wird im 3. Teil seiner Arbeit produktiv. „Zunächst ist zu unterscheiden zwischen der transzendentalen Einheit der Apperzeption und der Einheit des empirischen Bewußtseins. Stehen die Gegenstände möglicher Erfahrung nur nach der Seite der allgemeinen Form der Gesetzmäßigkeit a priori unter der transzendentalen Einheit der Apperzeption, müssen sie aber nach der Seite ihrer spezifischen Bestimmtheit durch Spekulation und Experiment allererst darunter gebracht werden, dann setzt dies die Selbständigkeit der empirischen Subjekte gegenüber der transzendentalen Einheit der Apperzeption voraus. Bedingung der Möglichkeit dieser Selbständigkeit ist die Selbständigkeit der Einheit des empirischen Bewußtseins gegenüber der transzendentalen Einheit der Apperzeption. Erst in der Folge gelungener Spekulation und gelungenen Experiments ist das empirische Subjekt nicht mehr nur eines möglicher, sondern wirklicher Erkenntnis, ein Funktionsorgan der allgemeinen Subjektivität.“ (S. 324)
Die Konsequenz aus dieser Überlegung ist die Schlussfolgerung, dass auch die transzendentale Einheit der Apperzeption und damit das Apriorische sich als Historisches erweisen kann. Das Apriorische ist dann der avancierte Stand der Vernunft in der Epoche. „Ist die transzendentale Einheit der Apperzeption die notwendige Einheit der Resultate der Wissenschaften, dann ist sie offenbar historisch bedingt. Sie ist ‚die ‚Einheit des Bewusstseins’, die in Newtons Wissenschaft objektiv geworden war’. Als solche ist sie abhängig von der historischen, mithin auch gesellschaftlichen Praxis der Einzelwissenschaften, und ihr Begriff ist nicht ohne Reflexion auf diese Praxis zu bestimmen.“ (S. 325)
Damit wird zwar die einseitige Auflösung des Gegensatzes von Apriorischem und Historischem, bei Kant und Fichte zugunsten des Apriorischen und bei Hegel zugunsten einer „Logifizierung des Historischen“, vermieden, aber es besteht die Gefahr des Relativismus und des Skeptizismus. „Die philosophische Reflexion muß vor der Alternative, entweder in einen robusten Hegelianismus zu flüchten oder aber den objektiven Wahrheitsbegriff, der auch derjenige Kants ist, preiszugeben, nicht kapitulieren. Kants Bestimmung der transzendentalen Einheit der Apperzeption als der objektive Erkenntnisurteile ermöglichenden Instanz kann durch die Reflexion auf die gesellschaftliche Praxis der Einzelwissenschaften pragmatisch begründet werden; der historische Charakter dieser Instanz kann durch die Reflexion auf die Geschichte der Philosophie aufgeklärt werden, ohne die Geltung in Genesis aufzulösen.“ (S. 326)
Wenn das Experiment zur notwendigen Bedingung naturwissenschaftlicher Erkenntnis gehört und dies in einem arbeitsteilig organisierten Forschungsprozess Voraussetzung neuer Erkenntnisse wird, dann ist Wissenschaft nicht von der Gesellschaft und ihrer Ökonomie zu trennen. „Arbeitsteilung, Akkumulation, Kooperation und Arbeit sind Bestimmungen, die ihren Ort nicht in den Naturwissenschaften oder der Transzendentalphilosophie haben. Sie stammen aus der Politischen Ökonomie und ihrer Kritik, mithin sind es ursprünglich Bestimmungen des materiellen Reproduktionsprozesses der bürgerlichen Gesellschaft. Daß dieselben Bestimmungen für die Reproduktion der bürgerlichen Gesellschaft einerseits und für die Naturwissenschaften und ihren Fortschritt andererseits grundlegend sind, verweist auf den systematischen Zusammenhang, in dem beide zueinander stehen.“ (S. 331)
Zurück zum Anfang
Diese Einsichten haben Auswirkungen auch für die Probleme der Transzendentalphilosophie und führen zu einer neuen Begründung eines objektiven Wahrheitsbegriffs. Im Gegensatz zur Theorie vom „Paradigmenwechsel“, der Wahrheit auf „die Billigung durch die jeweilige Gesellschaft“ (Kuhn, zitiert nach S. 326) versubjektiviert, zeigt Kuhne, wie sich ein objektiver Wahrheitsbegriff pragmatisch begründen lässt. „Die Notwendigkeit und Allgemeinheit der Erkenntnisse, ihre Wahrheit, ist dann (durch Reflexion der gesellschaftlichen Praxis, BG) pragmatisch begründet. Der mit der Entwicklung der großen Industrie entstehende funktionale Zusammenhang von Wissenschaft, Technik und materieller Produktion tritt in der pragmatischen Begründung der Wahrheit der Erkenntnisse objektiv in die Funktion ein, welche die philosophische Tradition, solange sie an dem objektiven Begriff der Wahrheit als der adaequatio intellectus et rei festhielt, dem Absoluten zugesprochen hat. Die Übereinstimmung von Intellekt und Sache ist nicht ontologisch garantiert, sondern funktional begründet. Dieser funktionale Zusammenhang ist historisch geworden. Aus seiner Wirklichkeit kann auf die notwendigen Bedingungen seiner Möglichkeit nur dann geschlossen werden, wenn an dem objektiven Begriff der Wahrheit festgehalten wird. (…) Die pragmatische Begründung der Geltung der besonderen Erkenntnis resultiert aus keinem Paradigmenwechsel, sondern aus der immanenten Kritik der Transzendentalphilosophie. Sie steht zu dieser (und zur philosophischen Tradition insgesamt) deshalb nicht im Verhältnis der abstrakten Negation, vielmehr zeigt sie, wie deren Ansprüche nur dann eingelöst werden können, wenn Philosophie nicht bei sich selbst bleibt, sondern in Theorie der Gesellschaft übergeht – freilich ohne in ihr aufzugehen.“ (S. 332)
Auch die Schwierigkeit mit Kants 3. Antinomie zwischen Freiheit und Naturnotwendigkeit lässt sich mit Kuhnes Begriff der pragmatischen Begründung der Wahrheit lösen. Sind nämlich naturwissenschaftliche Erkenntnisse nur durch experimentellen Eingriff in den Naturzusammenhang zu bekommen, dann ist menschliche Freiheit, die deren notwendige Voraussetzung ist, immer schon bei der Bestimmung der Naturkausalität vorausgesetzt.
Schlussbemerkungen
Einige der Denkfiguren dieses Buches kannte ich schon aus den Vorlesungen und Büchern von Professor Bulthaup; in dieser präzisen Zusammenfassung und immanenten Detailgenauigkeit und Kritik bringt das Buch von Kuhne Neues. Er dokumentiert den Stand der Kant- und Fichteforschung, kritisiert diese und triebt diesen Forschungsstand weiter.
In diesem Zusammenhang bleibt nur noch zu erwähnen, dass auch das moralische Gesetz bei Kant, welches die Dignität eines Naturgesetzes haben soll, aber zugleich als ein Fakt im empirischen Bewusstsein bestimmt ist, in der KrV auch pragmatisch begründet wird: als dauerhafte Alternative zum Krieg aller gegen alle (vgl. KrV, B 779 ff.). Dass Kriege weiter geführt werden und die geschichtsphilosophischen Möglichkeiten, die in der „großen Industrie“ liegen, bisher nicht aktualisiert wurden, liegt nicht an der richtig verstandenen Philosophie und Gesellschaftstheorie, sondern an der mangelnden Tathandlung der politischen Akteure.
Frank Kuhne, PD Dr. phil. Jg. 1956, lehrt Philosophie am Philosophischen Seminar der Leibniz Universität Hannover. Forschungsgebiete: Transzendentalphilosophie, Theorie des Selbstbewusstseins, Praktische Philosophie, Geschichtsphilosophie.
Diese Arbeit wurde von der Philosophischen Fakultät der Universität Hannover im Sommersemester 2006 als Habilitationsschrift angenommen und für den Druck leicht überarbeitet.
Zurück zum Anfang
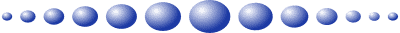
Hier können Sie Ihre Meinung äußern,
einen Beitrag in unser Gästebuch fomulieren,
Kritik üben oder
mit uns Konrakt aufnehmen...

|

Volltextsuche in:
Erinnyen Aktuell
Weblog
Hauptseite (zserinnyen)
Erinnyen Nr. 16
Aktuelle Nachrichten
der Argentur ddp:


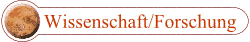

Wenn Sie beim Surfen Musikt hören wollen:

Weitere Internetseiten und unsere Internetpräsenz im Detail:

Audios, Fotos und Videos:
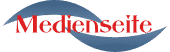
Die letzten Ausgaben der Erinnyen können Sie kostenlos einsehen oder herunterladen:



Erinnyen Nr. 18
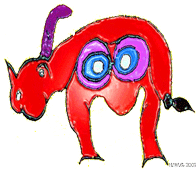


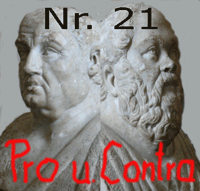
Nachrichten aus dem beschädigten Leben:

Unsere Zeitschrift für materialistische Ethik:

Unsere Internetkurse zur Einführung in die Philosophie:

Unsere Selbstdarstellung in Englisch:

Die Privatseite unseres Redakteurs und Vereinsvorsitzenden:

Unser Internetbuchladen:



|